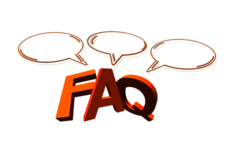FAQs
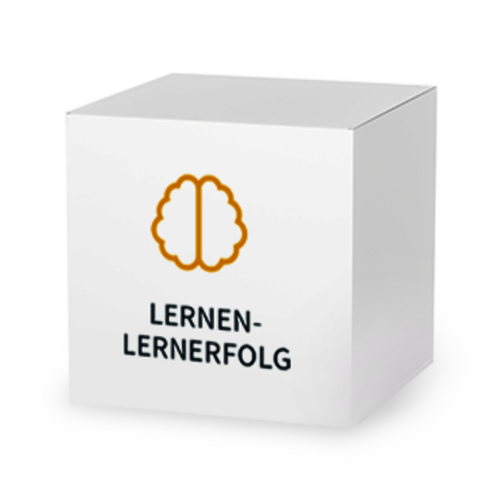
Der Begriff Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (LRS) dient als ein Überbegriff für Erwerbsprobleme im Lesen und Schreiben, unabhängig vom Ausprägungsgrad.
Die Unterschiede zwischen den Begrifflichkeiten liegen weniger an inhaltlichen, sondern vielmehr an lokalen oder juristischen Gegebenheiten.
In beiden Fällen sind die Lese-Rechtschreibfähigkeiten im Vergleich zur Klassenstufe schwächer ausgeprägt und bedürfen spezifischer Förderung.
Für eine Lese-/Rechtschreibstörung braucht es eine klinisch-psychologische Diagnostik. Dieser Diagnoseprozess wird vielmehr bei Unsicherheiten hinsichtlich möglicher Ursachen, Komorbiditäten, dem Schweregrad, der unterschiedlichen Sichtweisen von Lehrkräften und Eltern zum Thema oder bei nicht vorhandenem Lernfortschritt trotz Förderung durchgeführt.
Eine Lese-Rechtschreibschwäche dagegen wird von Pädagoginnen und Pädagogen festgestellt. Das Ziel einer pädagogischen Diagnostik ist das Erkennen von Stärken und Schwächen um die richtigen Fördermaßnahmen abzuleiten. Um geeignet Fördermaßnahen einzusetzen braucht es nicht zwingend eine klinisch-psychologische Diagnostik.
Im schulischen Kontext werden die Fördermaßnahmen nicht nur auf Kinder und Jugendliche mit klinisch-psychologischer Diagnose eingegrenzt, sondern alle Schülerinnen und Schüler mit Lese-/Rechtschreibschwierigkeiten werden in entsprechende Fördermaßnahmen im Rahmen des Unterrichts eingebunden (RS Nr. 24/2021).
Grundsätzlich gelten bei Lese-/Rechtschreibschwäche die gleichen gesetzlichen Bestimmungen der Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung, die für alle Schülerinnen und Schüler gelten (siehe §§ 18, 20, 38 Schulunterrichtsgesetz, BGBl. Nr. 472/1986, und Leistungsbeurteilungsverordnung, BGBl. Nr. 371/1974 jeweils idgF.). Unterstützungen im Bereich Lese-/Rechtschreibschwäche im schulischen Kontext sind gemäß dem Rundschreiben 24/2021 möglich.
Bei einer diagnostizierten Lese-/Rechtschreibstörung nach ICD-10 oder AWMF-S3-Leitlinien, ist der § 11 Abs. 8 LBVO anzuwenden. Dabei sollten die notwendigen pädagogischen Hilfestellungen und symptomspezifischen individuellen Fördermaßnahmen in der Schule umgesetzt werden. Die entsprechenden möglichen Hilfestellungen finden Sie im RS Nr. 24/2021 (Seite 4 und 5).
Bei der Beurteilung der schriftlichen Arbeiten in den sprachlichen Gegenständen ist auf die Lese-/Rechtschreibschwäche Rücksicht zu nehmen, indem die Rahmenbedingungen entsprechend dem RS Nr. 24/2021 angepasst werden. Die Bildungs- und Lehraufgabe des betreffenden Unterrichtsgegenstandes muss grundsätzlich erreicht werden. Die jeweiligen Kriterien (Inhalt, Ausdruck, Sprachrichtigkeit und Schreibrichtigkeit) für die Beurteilung von Schularbeiten sind gleichermaßen zu bewerten. Wichtig zu beachten ist, dass der Bereich Schreibrichtigkeit keinesfalls die einzige Grundlage der Leistungsbeurteilung sein darf. Verstöße im Bereich der Rechtschreibung sowie der Grammatik sind Fehlerkategorien zuzuordnen. Identische Fehler sind dabei nur einmal zu werten (§ 15 Abs. 3 LBVO).
Schularbeiten sind nach dem Inhalt, dem Ausdruck, der Sprachrichtigkeit und der Schreibrichtigkeit zu beurteilen. Hierbei handelt es sich aber um gleichwertige Bereiche, d.h. für die Beurteilung der Schularbeiten in der Unterrichtssprache und in den lebenden Fremdsprachen müssen nach Maßgabe des Lehrplanes alle Aspekte (§ 16 LBVO) in den wesentlichen Bereichen überwiegend erfüllt werden.
Bei der Reifeprüfung in Deutsch und weiteren Unterrichtssprachen - anders als bei Schularbeiten - wird beim Kompetenzbereich „normative Sprachrichtigkeit“ darauf Bedacht genommen, dass die Kompetenzbereiche so gewählt sind, dass die „normative Sprachrichtigkeit" über beide Schreibaufgaben hinweg beurteilt wird und Fehler in einem Text alleine nicht zu negativen Beurteilungen führen können; bei den Schularbeiten stellt die Schreibrichtigkeit hingegen einen eigenen Bereich dar.
Für die Jahresbeurteilung ist die Rechtschreibkompetenz nicht als wesentlicher Bereich zu interpretieren, sondern als Teilkompetenz der Schreibkompetenz. D.h. selbst bei wegen Rechtschreibung negativ beurteilter Schularbeiten kann die Jahresnote positiv sein.
Ja. Eine positive Gesamtbeurteilung ist auch dann möglich, wenn negative Leistungen bezüglich Schreibrichtigkeit durch positive mündliche Leistungen und Mitarbeit aufgewogen werden können. Verschiedene Formen der Leistungsfeststellungen sind zu berücksichtigen und deren Einsatz ist als grundsätzlich gleichwertig anzusehen.
Bei der Beurteilung von Schularbeiten in Deutsch sind die Bereiche Inhalt, Ausdruck, Sprachrichtigkeit und Schreibrichtigkeit in gleichem Ausmaß heranzuziehen. Die Schreibrichtigkeit ist nur als Teilbereich der Gesamtleistung zusehen.
Bei einer diagnostizierten Lese-/Rechtschreibstörung kann von einer Körperbehinderung im Sinne des Gesetzes ausgesprochen werden. Schüler/innen, die wegen einer körperlichen Behinderung eine entsprechende Leistung nicht erbringen können oder durch die Leistungsfeststellung gesundheitlich gefährdet wären, sind entsprechend den Forderungen des Lehrplans unter Bedachtnahme auf den wegen der körperlichen Behinderung bzw. gesundheitlichen Gefährdung erreichbaren Stand des Unterrichtserfolges zu beurteilen, soweit die Bildungs- und Lehraufgabe des betreffenden Unterrichtsgegenstandes grundsätzlich erreicht wird. Auf dieser Grundlage liegt es im Ermessen der Lehrkraft, wie die Leistungsfeststellung idealerweise erfolgen kann.
Empfohlen wird aber vielmehr ein Zeitzuschlag, Rechtschreibfehler teilweise oder gar nicht zu berücksichtigen, oder zeitgemäße Hilfsmittel, wie z.B. Arbeit am PC, Verwendung von Textverarbeitungsprogrammen.
Der Ablauf einer klinisch-psychologischen Diagnostik für die Abklärung der Lese-Rechtschreibstörung ist festgelegt und beinhaltet folgende Punkte:
- Fragestellung
- Anamnese
- Verwendung von standardisierten Testverfahren über den kognitiven Entwicklungsstand und Schulleistungen
- Ergebnis, Diagnose
- Empfehlung
Die Feststellung einer Lese-/Rechtschreibstörung nach ICD-10 oder der AWMF-S3-Leitlinie darf nur durch eine klinische Psychologin/einen klinischen Psychologen bzw. ein ärztliches Gutachten erfolgen. Bei den Ärztinnen/Ärzten stellt das Ärztegesetz die rechtliche Grundlage dar. Bei Unklarheiten bezüglich eines außerschulischen Gutachtens kann auch die Expertise der Schulpsychologie herangezogen werden.
Bei Vorliegen einer Lese-/Rechtschreibstörung sind die notwendigen pädagogischen und symptomspezifischen Fördermaßnahmen in der Schule umzusetzen. Es sollten, wenn möglich, alle Fördermöglichkeiten ausgeschöpft werden. Zusätzlich kann z.B. ein Zeitzuschlag oder zeitgemäße Hilfsmittel gewährleistet werden. Bei Fragen und Unsicherheiten kann sich die Lehrperson an die Schulpsychologie wenden.
Nein, eine Diagnose ermöglicht nicht automatisch einen Notenschutz. Die Schülerinnen und Schüler mit einer Lese-/Rechtschreibstörung sind unter Bedachtnahme auf den wegen der Beeinträchtigung erreichbaren Stand des Unterrichtserfolges zu beurteilen. Die Bildungs- und Lehraufgabe des betreffenden Unterrichtsgegenstandes sollte dabei grundsätzlich erreicht werden. Das bedeutet z.B., wenn überwiegende oder auch alle Teilbereiche der Lernziele mit Nicht Genügend beurteilt worden sind, kann die Gesamtleistung in der Schulnachricht oder im Zeugnis trotz klinischer Diagnose negativ beurteilt werden.
Nein, einen solchen Automatismus gibt es nicht.
Bei einer nachweislich vorliegenden Diagnose von LRS nach ICD-10 oder AWMF-S 3 wäre es wünschenswert zumindest auf das Rundschreiben 24/2021 Bezug zu nehmen.
Die Feststellung einer Lese-/Rechtschreibstörung nach ICD-10- oder der AWMF-S3-Leitlinie setzt eine mehrjährige Ausbildung in der Anwendung klinisch-psychologischer Methoden voraus, daher ist es diesem Berufsstand vorbehalten. Die Vereine müssen diese Kriterien erfüllen. Bei Bedarf kann der schulpsychologische Dienst beigezogen werden.
Grundsätzlich ja, aber es ist empfehlenswert, bei Verschlechterungen oder Verbesserungen der Leistungen eine Verlaufsdiagnostik zu machen.
Nein. Für die Förderung im Bereich der Lese-/Rechtschreibschwierigkeiten ist eine pädagogische Diagnostik ausreichend. In Zweifelsfällen kann eine klinisch-psychologische Diagnostik durchgeführt werden.
Ja, sowohl die Diagnose F81.0 Lese- Rechtschreibstörung als auch die Diagnosen F81.1 isolierte Rechtschreibstörung und F81.3 Kombinierte Störung schulischer Fertigkeiten werdne vom Rundschreiben 24/2021 erfasst.
Die Diagnose für LRS wird in der Regel schon in den Jahren davor gestellt, wenn die Symptomatik erstmals auffällt. Wird ein LRS-Befund erstmals im Abschlussjahr präsentiert, erscheint eine genaue Exploration der bisherigen Maßnahmen (vorhandene pädagogische Diagnosen, Trainings, Umsetzung in der bisherigen Schullaufbahn etc.) unerlässlich. Für die Reife- und Diplomprüfung ist es unabhängig von einer klinischen Diagnose, dass die Schülerin/der Schüler die gleichen Rahmenbedingungen vorfindet, die sie/er bereits bis zur Matura während der Schularbeiten zur Verfügung gestellt bekam.
Die pädagogische Unterstützung und Berücksichtigung der Lese-Rechtschreibstörung ist nicht abhängig von privaten und außerschulischen LRS Förderungen. Eine gesetzliche Regelung für den Nachweis von außerschulischen Förderungen und Einblick in diese Förderinhalte ist nicht gegeben. Jedoch wäre es für alle Beteiligten von Vorteil, wenn eine Transparenz vorliegt, um die bestmögliche Förderung mit entsprechenden Rahmenbedingungen für die betroffenen Schülerinnen und Schüler im schulischen Kontext zu ermöglichen. Wenn nämlich im Rahmen von Förderungen Fortschritte erreicht worden sind, können die schulischen und individuellen Hilfestellungen an die aktuelle Lese/Rechtschreibleistung der Schülerinnen und Schüler angepasst werden.
Wenn im Schulalltag eine Lese-/Rechtschreibschwierigkeiten festgestellt und entsprechend berücksichtigt wurde, ist kein gesondertes Gutachten für die standardisierte Reife- und Diplomprüfung erforderlich (siehe hierzu bitte auch die entsprechende Grundlage seitens des BMBWF, Rundschreiben Nr. 24/2021: Richtlinien für den Umgang mit Lese-/Rechtschreibschwierigkeiten (LRS) im schulischen Kontext, S. 5). Es kann im Zweifelsfall aber angefordert werden.